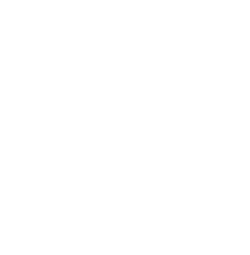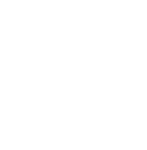Eugen Batz. LITERATUR.
Seit der ersten, profunden Interpretation zum künstlerischen Ansatz von Eugen Batz durch Werner Haftmann sind zahlreiche Katalog- und Zeitschriftenbeiträge erschienen. 1984 veröffentlichte der Schriftsteller Dieter Hoffmann eine umfassende Monografie zu Person und Werk. Neuere Veröffentlichungen betrachten sein Werk unter kunsthistorisch- wissenschaftlichen Aspekten.
- DIETER HOFFMANN | NOTIZEN ZUR AQUARELLKUNST VON EUGEN BATZ
Sein verehrter Lehrer am Bauhaus und an der Düsseldorfer Akademie, Paul Klee, urteilte 1932 in einem Brief: Batz schreitet immerzu fort, er hat sehr viel verschiedenartige Dinge gemacht, jedes in seiner Art gut.“ Er hat gemalt und gezeichnet, radiert, photographiert und Plastik gemacht, auch Schmuck für seine Frau, er hat ein Haus gebaut und seinen Garten angelegt. Ein Bauhaus Künstler durch und durch. Sein Werk kommt vom Bauhaus her, geht vom Bauhaus aus. Es ist wohl gemerkt zu unterscheiden: Von einem Bauhaus, das sich als ein Hort des Handwerks verstand, nicht von jenem, das sich der Industriekultur verschrieb, als das es heute einseitig gesehen wird. In allem, was er tat, setzte Engen Batz auf Traditionen. (Im Alter hat er sich eine inspirierende Sammlung hellenistischer Kleinkunst angelegt) Nicht alles aber, was seine Kunst beförderte, ist zurückzuführen auf Klee; die Vorkurse des Bauhauses dürften tiefe Spuren hinterlassen haben, und die wurden von Johannes Itten geleitet. Vieles, was sich später bei Heerscharen von Epigonen, die nicht zeichnen konnten, als freie Kunst gefiel, ist nichts als angewandter Vorkurs, verselbständigtes Hantieren mit Strukturen.
Auch Batz hat sich zeitweilig der Erkundung rein der Struktur, der Struktur an und für sich, hingegeben. Vielleicht wollte er der Schönheit seiner abstrakten Garten-Bilder ein Moment rauher Wirklichkeit an die Seite stellen, als auch er mit Sand und Asche umging. Ähnliches hatten die Dadaisten begonnen und Batz‘ jüngere Zeitgenossen Antoni Tàpies und Karl Fred Dahmen ausgebildet; der jetzt sechzigjährige Anselm Kiefer pflegt dergleichen bis in die unmittelbare Gegenwart. Josef Hegenbarth verwendet mit Vorliebe Papiere, von denen er Ergebnisse, die ihm misslungen schienen, mit der Wurzelbürste abgeschrubbt hatte: Aus Ökonomie entstand Reiz.
Zwei große Strömungen des Informel in den fünfziger und sechziger Jahren indes konnten sich auf zwei einander ganz entgegengesetzte Quellen berufen: den extrovertierten Jackson Pollock und den introvertierten Wols. Aber das wäre zu wenig. Das Pointillistische, Musivische, das Puzzle, sollte als ein dritter Quell fixiert werden, aus dem viele tranken, auch Eugen Batz. (Es ist vielleicht aufschlussreich, einmal wieder daran zu erinnern, dass während des Zweiten Weltkrieges, also zeitgleich mit Pollock in New York und Wols in Paris, gerade in Wuppertal, in der Lackfabrik von Dr. Kurt Herberts, der Stuttgarter Willi Baumeister mit Träufelbildern informell experimentiert hat. Nur hat er das nicht als Erfindungen heraus gestellt.)
Wenn wir die Genealogie ernst nehmen, finden wir, dass Itten selbst in Stuttgart Schüler Adolf Hölzels war. Längst ist nicht mehr bezweifelt, dass Hölzel, Lehrer Schlemmers, Baumeisters, Max Ackermanns und vieler anderer, mit Klee und Kandinsky zu den Begründern der gegenstandsfreien Malerei gehört. Am Rande bemerkt: Als Hölzel aus dem Stuttgarter Lehramt schied, bemühten sich seine Schüler, Paul Klee als dessen Nachfolger zu gewinnen. Charakteristisch für Hölzel ist der oben genannte musivische Stil, wie er zur Zeit der Jahrhundertwende auf andere Weise auch von Gustav Klimt, Augusto Giacometti und Otto Freundlich gepflegt wurde, später hei Serge Poliakoff und Roger Bissière. In diesen Traditionen, unter anderen, sollte Eugen Batz gesehen werden.
Das „Mosaik“ bleibt eine seiner Besonderheiten, seit den ersten reifen Aquarellen aus dem südfranzösischen Collioure, dem Emigrationsversuch 1933, und bindet ihn von da an unauslöschlich in die Kunstgeschichte ein. Dieser kunstgeschwängerte Küstenort, von namhaften Künstlern geradezu durchsetzt, forderte ihn insgeheim zu konkurrierenden Leistungen. Jene Blatter sind von kultivierter malerischer Süße, wie sie auch die ersten Arbeiten nach Kriegsende und Befreiung auszeichnet.
Die Zeit der Diktatur und des Krieges, der Inneren Emigration, war für Batz dann eine des Rückzugs in die Stille, er zeichnete nur noch, zumeist Landschaften der heimischen Umgebung, kleine asketische Formate, Bleistift und Silberstift. Erst - und immer wieder - der eigene Garten mit Blumen und Kräutern, dann bald die allmählichen Möglichkeiten zu Reisen ins Ausland bescherten dem Künstler, der nun auf der Höhe seines Lebens stand, eine reiche Aquarell-Ausbeute. Dass er dennoch nicht für den Handel produzierte, gibt den Arbeiten eine wertvolle Aura.
Das blumistische Interesse hat Eugen Batz wiederum mit einem Künstler des Neo- Impressionismus gemein, dem Berliner Curt Hermann, Freund Henry van de Veldes und glücklicher Bewohner des Parkes seiner Schwiegereltern, Schloss Pretzfeld in Franken. Hermann verflüssigte das Blühen geradezu, vorweggenommener Sam Francis – wieder eine andere Spielart des Informel.
Wiederholt ist hier vom „Informel“ die Rede. Strenggenommen hat das Informel, das Formfreie, die weitestgetriebene Abstraktion, bei Batz nur ephemere Bedeutung, zumeist war seine Bildthematik nachvollziehbar intendiert. Gewiss, er gestattete sich auch den Automatismus des Traums. Aber mehr gilt für ihn, wie es einmal der nachexpressionistische Landschafter Erich Heckel – oder einer seiner Gewährsleute – treffend gesagt hat: Man spüre jeweils unter der Oberfläche seiner verschiedenen Gegenden den geologisch bestimmbaren Grund, ob vulkanisches Gestein oder Kalkboden und so weiter.
Batz legte mit seinen Aquarellen aus fremden Ländern, Schweiz, Tessin, Frankreich, Italien, Spanien, Griechenland, Türkei, Tunesien einen regelrechten Thesaurus an, verwahrte die Blätter in Kassetten-Rücken je mit einem Fähnchen des betreffenden Landes. Er bevorzugte einheitliches Format, gelegentlich größer, lieber aber kleiner bis zur Miniatur.
Es gab in Deutschland nach 1945 nur noch einen Male r, der so entschieden die diversen Landschaftseindrücke suchte und sich seinem Willen, diese zu gewinnen, hergab: Ernst Wilhelm Nay. Mit dem Unterschied, dass Nay vermögender war und von spontanerem Temperament. Auf prüfbare Lokalisierung der Landschaft kam es Nay dabei nicht an, seine Kunst hatte gegenstandsfrei absolut zu sein.
Absolut war Batz in eben der Lokalisierung. Er hat einmal eine wunderbare Antwort gegeben, auf die Frage um ein Aquarell aus Ischia: Ist das nun konkret oder abstrakt?“ sagte er: „Das ist Ischia.“ Batz‘ Zeichnungen und Aquarelle dieser süditalienischen Vulkaninsel sind „tuff“, wie das Gestein. Sie laden ein, zwischen den Klüften und den Serpentinen mit dem Auge spazieren zu gehen, und man hat die backende Wärme des Steins, der die Sonne zurückstrahlt, die frischen Luftzüge aus dem Gezweig, das Meer, aus dem alles aufragt. Also bei aller Abstraktion, auch bei aller Altmeisterlichkeit in der Feinheit der Ausführung, Qualitäten, die eigentlich Qualitäten des Impressionismus sind.
Ein Zeitgenosse van Batz und Nay, zum Exempel Bernard Schultze, imaginierte seine Aquarelle in einem ortlosen Traumreich, einem romantisch wuchernden Wald, von dem man nicht sagen kann, wo er sei. - Das Halbabstrakte, wenn wir es denn einmal so nennen wollen, oder Halb- Informelle, hat Batz mit zwei Dresdnern gemein, mit Helmut Schmidt-Kirstein (1909 -1985) und dem jüngeren Max Uhlig (geb. 1937); beide haben ihre Landschaftsaquarelle jeweils genau verortet.
In größerem Zusammenhang der Kunstgeschichte, umfassenderen Zeiträumen, wäre zu Batz’ Vorgängern auch William Turner zu zählen., der den verschiedensten Landschaften nachjagte – Thamse und Rhein, Venedig und Bodensee – und sie alle in dem ihnen ihn eigenen Dunstkreis sah.
Das Erlebnis der spanischen Landschaft, zum Beispiel, ist bei Eugen Batz ein tektonisches; auch gestattet es kubische Elemente einzubringen. Traf er die Landschaft so menschenleer an, wie er sie widergab, oder sollte die Abkehr vom Menschenbild ein Ausdruck der „Moderne“ sein? In den Griechenland-Aquarellen hat der Mensch Zutritt, er ist in kleinen Gruppen mit Fels und Meer verwoben. Intensiver noch nimmt Batz den Menschen ins Spätwerk der Tuenesien-Aquarelle auf, die er 1976, als Einundsiebzigjähriger begann und alljährlich wiederholte.
Als wollte er die berühmte Tunis-Reise von Klee, August Macke und Louis Moilliet von 1914 wiederholen, den teppichschönen Orient der Kairuan-Serie. Ihm offenbaren sich im zehrenden Licht der Wüste Farben wie sie André Gide in seinem Tagebuch notiert hat, und doch gebrochenere als bei diesen Malern und diesem Dichter. Die Höhlen und Bazare werden von Vergänglichkeit überschleiert. Nur manchmal „erblühen“ die Figurengruppen wie Blumensträuße: ein neuer Orientalismus, der an jenen des 19. Jahrhunderts anknüpft, für den als berühmtester Name Eugen Delacoroix steht. Ist es das nahende Alter mit dem erahnten Tod, das ein bei Batz bisher kaum gekanntes erotisches Moment in die Bilder bringt? Ein Blick auf Verlorenes? Vereint mit Sakralem. Solche „Inhalte“ geben dem Spätwerk seinen expliziten Wert.
In den Gemälden und in den Aquarellen aus Tunesien zeigen sich dem Betrachter auch alte Ruinen. Eine Erinnerung an die Frühzeit mag da wachgeworden sein. Batz hatte 1932 eine Radierung mit dem Titel „Ruine“ gemacht, ein Blatt, das Werner Haftmann nach dem Krieg in das Mappenwerk der Bremer Galerie Hertz aufgenommen hat. Es lässt sich nicht sagen, ob dies Runie reine Phantasie war, oder vom Landschaftspark Wörlitz – mit seinen künstlichen Ruinen – angeregt wurde. Es darf aber vermutet werden, dass Batz etwas von der Rokokozärtlichkeit der Dessauer Parklandschaft in sich aufgenommen hat, das ihm zuletzt noch in der einst römisch beherrschten Welt Nordafrikas zugute kam. Auf jeden Fall ist es bemerkenswert, wie sich Ruinen, als aufgelöste, poröse Architektur, in den Kosmos des „Informellen“ einpassen.
Batz verwendete gern kostbaren Büttenkarton, gewissermaßen eine prästabilierte Struktur. Aber er verstand es auch, mindere Papiere zu adeln, machte daraus sogenannte gestrichene Papiere, deren kalkiger Grund den Aquarellen gelegentlich etwas von Freskomalerei verleiht. Er verdünnte Gouache, dass sie wie Aquarell wirkt, nur stumpfer. Gern legte er sparsam Graphit oder sogar Kugelschreiber an, höhte mit Weiß. Er setzte auf die Grisaille gern Flecken als farbig Akzente, Flecken, die den gerinnenden Trockenprozess ablesen lassen. Flecken – da haben wir es wieder: „la tache“, der Fleck, der dem Tachismus den Namen gab, dem Tachismus, welcher in der Kampfzeit oft als Synonym für „Informel“ benutzt wurde. Auch aquarellierte Eugen Batz Manchmal auf Photopapier, eigentlich ein widriges Material, das aber unter den Händen dieses Künstlers wie Perlmutt zu schimmern vermag.
Welche Verschiedenheit, welcher Reichtum der Kunst! Im Jahr 1905, dem Todesjahr Adol Menzels, dem Gründungsjahr der ‚Brücke’, wurden in Deutschland Künstler geboren, die höchst verschiedene Wege gingen: Der neuklassische Bildhauer Hermann Blumenthal, der Realist – Impressionist – Expressionist – Ernst Hassebrauk, die „Abstrakten“ Fritz Winter und Eugen Batz ... Ein pluarlistisches Jahrhundert.
Es sind um Batz viele Namen genannt worden, und viele wäre noch zu nennen, das schmälert ihn nicht im geringsten – im Gegenteil, reiht ihn einen bedeutenden Kanon der Kunst seiner Zeit.
Der Autor dieses Beitrages ist Verfasser der Monographie Eugen Batz. Leben und Werk, herausgegeben von Johannes Doebele, Belser Verlag, Stuttgart und Zuerich, 1984
(aus: Eugen Batz. 1905-1986. Zum 100. Geburtstag. Gemälde und Aquarelle. Ausst.-Kat. Von der Heydt-Museum, Wuppertal, hg. Von Sabine Fehlemann, mit Beiträgen von Antje Birthälmer, Beate Eickhoff und Dieter Hoffmann, 2005.)
- WERNER HAFTMANN | ESSAY
In dieser Mappe wird von nicht Geringerem als von einer Entdeckung berichtet. Die vorgelegten graphischen Blätter des rheinischen Malers Eugen Batz (geb. 1905 in Velbert/Rhld.) sind bereits 1932 entstanden; sie wurden jetzt erst aufgespürt, als eine in den Jahren 1946/47 entstandenen Reihe seiner Radierungen, die in einer folgenden Mappe einem weiteren Kreis von Graphikfreunden zugänglich gemacht werden wird, anläßlich einer Ausstellung in der Galerie Dr. Rusche in Köln 1947 die freudige Aufmerksamkeit des Verfassers erregte. Der Fund war auch deshalb so erregend, weil das deutliche graphische Vakuum in der deutschen Kunst seit ca. 1930, für das das politisch erzwungene Absinken der modernen Kunst in den Untergrund des kulturellen Lebens nur eine sehr äußerliche Erklärung bietet, sich nun zu einem Teil aufzufüllen beginnt. Gewiß, - die geniale graphische Schaffenskraft E. L. Kirchners hatte sich auch im 4. Jahrzehnt unseres Jahrhunderts bewährt und eine Höhenlage erreicht, die zu entdecken und bekannt zu machen ein dringendes Anliegen ist, - Beckmann, Klee und Baumeister hatten immer wieder einzelne Blätter beigesteuert, Marcks die seine Bildhauereien begleitende Serie der Holzschnitte fortgesetzt und Matarés spielend grübelnde Geistigkeit begann bereits im Holzschnitt das Mittel zu finden, das, seit 1945 in volle Freiheit gesetzt, ihn zu seinen großartigen graphischen Leistungen heute befähigt. Und doch - im Gesamtbild der Kunst verlieren sich die graphischen Leistungen. Das gilt besonders für die Radierung. Die hier vorgelegten Blätter - geätzte Radierungen mit Aquatinta - stehen in der Kunst des 4. Jahrzehnts ziemlich allein da. Dieser ihr origineller Wert würde nicht eben viel besagen, wenn nicht die künstlerische Qualität dieser Blätter und ihr geistiges Anliegen ihnen eine besondere Wichtigkeit geben würde.
Beschäftigung mit Graphik ist immer Sache einer abstrakten Verliebtheit. In der stillen, schauenden, liebevollen Betrachtung erst wird das graphische Blatt lebendig. Man muß warten können, bis das Blatt von selbst zu sprechen beginnt. Es wird seine Erzählung beginnen mit dem seltsamen Glanz seiner Oberfläche, wird uns der geheimnisvollen Legende seiner graphischen Zeichen nachsinnen machen, wird schließlich im harmonischen Entfalten seiner tonigen Formen uns das ästhetische Vergnügen gewähren, das uns jedes in einem inneren Gleichgewicht ruhende Formenensemble - auch in Natur und Kosmos - gibt. Aber es gehört zur inneren Qualität von wirklichen Kunstwerken, daß sie nicht nur ein ästhetisches Vergnügen gewähren, sondern eine geistige Anschauung zu vertreten wissen, d. h. eine künstlerische Methode zur Bewältigung der Welt.
In dieser Mappe liegt ein kostbares Blatt; es trägt den Titel „Herbst“. Man kann ein solches Blatt wohl kaum anders bezeichnen, denn als lyrisches Gedicht der reinen Sichtbarkeit. Zugrunde liegt offenbar nichts als ein drängendes lyrisches Gefühl um den Wortklang „Herbst“, zu dem sich dann im bildnerischen Spiel Wortzeichen formen, Zeichen, die keinen eigentlich gegenständlichen Inhalt meinen. Diese Zeichen sagen wohl Baum oder Wald oder fallendes Laub, aber meinen es nicht gegenständlich. Sie sinnen dem silbernen, ungegenständlichen Getön des Wortklanges nach und finden im Klang eine ferne, melodische Erinnerung auch an die gegenständliche Welt. Denn das Bildnerische ist eine Angelegenheit der durch die Erlebnisse des Auges ausgefüllten inneren Vorstellung. Will sich nun eine lyrische Ergriffenheit bildnerisch ausdrücken, so wird sie dies in sinnlich erfahrenen Zeichen tun; im sinnenden Spiel mit den Formen finden sich die gegenständlichen Erinnerungen wie von selbst ein, sie tauchen herauf wie reine, abstrakte Formen, verhüllen sich auch sofort wieder in der Hermetik der reinen graphischen Zeichen und entlassen schließlich aus sich ein großes Schriftzeichen, - diese sehnsuchtsvolle Kurvatur eines Herzens. So entsteht ein hermetisch verhülltes bildnerisches Gleichnis - ein „imago“ - für das, was in unserer Seele bewegt, wenn uns in der dunklen Stille der lyrischen Stunde das Wort Herbst zufliegt, - nicht dieser oder jener Herbst mit diesen oder jenen Erinnerungen, sondern der allgemein dichterische Klang, der in diesem Wort enthalten ist, der wohl ganz anonym im ganzen menschlichen Geschlecht angelegt sein muß und der hier nur in der Variante der modernen Sensibilität erscheint. Es ist das die gleiche Sensibilität, die Mallarmé erstrebte und die heute ihre wundervolle Blüte im Werk des italienischen Dichters Montale - in seiner „poesia ermetica“ - findet. Das überindividuelle Dichten! Liegt nicht auf diesem Blatt der sanfte Widerschein des fernen Ostens? - So wie die Chinesen einst zu dichten wußten - Worte, einzelne Bildklänge als Gesamtsymbol eines menschlichen Gefühls - wie der Gesang desjungen Kaisers Wu-ti (157-87) auf den Herbstwind:
Weht jetzt der Herbstwind und treiben
weißziehende Wolken.
Gilbt das Gras und das Laub, streichen
die Enten nach Süden.
Orchideen in reifer Pracht ihrer Blüte,
duftende Chrysanthemen.
Denke ich an mein süßes Lieb
und kann’s nicht vergessen.
Treibt quer über den Fluß Fen
die schwimmende Pagode:
In der Mitte des Stromes kräuselt sich
weißer Schaum. Flöte und Trommel geleiten das Singen
der rudernden Knechte.
Aber zwischen Fest und Gesang
weint mein so trauriges Herz.
Aber wie arm im Klang ist meine Übersetzung, - nur das Gestänge der schweren, vielsilbrigen Worte ohne das silberne Klingeln der einsilbigen chinesischen Vokalität zwischen Wort und Wort! Darauf aber käme es auch bei unserem Blatt an: — zwischen dem durchschimmernden Gestänge der gegenständlich-erinnerten Zeichen das Klingen der Empfindung zu spüren, die, wie ungeboren, zwischen den abstrakten Formen und der leisen, gegenständlichen Erinnerung an die herbstliche Landschaft schwebt. Und welch stilles Glück, wenn wir in staunender Gewöhnung des Auges langsam durch das sanfte Klingen der abstrakten graphischen Bewegung hindurchsehen bis zu jenem Gegenständlichen der herbstlichen Landschaft und nun im erregten Glück des Wiedererkennens der lyrischen Empfindung ganz gegenständlich innewerden, die dieses graphische Spiel erst ausgelöst hat, - der überindividuellen Empfindung HERBST also innewerden. Etwas in uns sträubt sich, diese Kunst „abstrakt“ zu nennen und sie damit einzuordnen in eine moderne Malmethode. Sie ist nicht „abstrakt“, sie ist hermetisch. Sie verhüllt in selbständigen, reinen, bildnerischen Zeichen ein immer wieder zu erfühlendes, zu gebärendes lyrisch-gegenständliches Erlebnis des Menschen. Es ist dies das Geheimnis dieser hermetischen Kunst, daß sie das Ungeborene unserer gegenständlichen Empfindung mit bildnerischen Mitteln anschaubar und mit dichterischen Mitteln erlebbar macht, uns nicht nur sehen, sondern sehend fühlen lehrt. Sie findet für die lyrisch-gegenständliche Ergriffenheit ein bildnerisches Siegel, hinter dem die Welt und das lyrisch-allgemeine Weltgefühl des Menschen verwahrt liegt, bis unsere gleichgestimmte Sensibilität für uns das Siegel löst. Dies mag man auch im Blatte „Wasserpflanzen“, auch in den so andersartigen Blättern „Torso“, „Maske“ nacherleben.
Gerade vermöge ihrer hermetischen Doppeldeutigkeit können diese graphischen Zeichen eine außerordentlich realistische Aussagekraft gewinnen. Das Blatt „Ruine“ ist das Bild eines bestimmten, niedergebrannten Hauses, die aus zerfressenem, fleckigem Gewände, aus sinnlosen Arabesken ausgeglühter Träger und Gestänge, aus dumpfen Müll der Schutthaufen lebendig werden und aus dem ruinösen Ensemble seltsamer graphischer Figurationen ein eindringliches, übernahes Bild in der Vorstellung des Künstlers wachrufen. In Künstlern geschieht so etwas: Piero di Cosimo erfand sich seltsame Bilder aus den fleckigen, bespuckten Wänden italienischer Tavernen, Lionardo aus den Figurationen treibender Wolken. Das Bild wird gespenstisch übernah. Auf dem hellen Plattengrund hocken die verfließenden Flecken der Aquatinta wie melancholische Lebewesen, und der fressende Strich der geätzten Linien legt ein brüchiges Gerüst durch die hellen Pläne. Zu nah wird alles, zu wirklich, wie im Traum, als sei dies die Szenerie, auf die sogleich das magische Geknäuel Kafkascher Figuren springen würde und so tun würde, als sei alles in Ordnung. Ein programmatischer Surrealismus, der nur mit der spezifisch modernen Sensibilität sieht und dem im fühlenden Sehen aus Dingen Gestaltformen werden, die die Existenz dieser Dinge für uns wirklicher machen, weil sie in unsere eigene lyrische Empfindung eintreten und so in uns heimisch werden.
Einen tiefen Einblick in das Werden der Bildgestalt gewinnen wir, wenn wir in stiller, wartender Betrachtung das Blatt „Nächtliche Insel“ wirklich schauend erleben, In diesem Blatt geht die bildnerische Phantasie von einem unmittelbaren optischen Erlebnis aus, von einem „Motiv“. Auf einer Reise nach der Insel Rügen (1932) zeichnete und radierte der Künstler eine weite, einsame Bucht, die der berühmte Kreidefelsen abschließt. Diese Blätter sind uns erhalten. Wir können nun mit ihrer Hilfe die Elemente dieser bestimmten Landschaft deutlich in der „Nächtlichen Insel“ wiederfinden: die weite Bucht mit den beiden Schiffen, im Vordergrund der dünne, wehende Baum, im Hintergrund die Steilküste. Aber aus der steilen Weiße des Kreidefelsens ist schon eine selbständige Form geworden, die wie eine schimmernde Lampe im Dunkel des meerumspülten nächtlichen Eilandes hängt. Und so gerät alles in die Trift der dichterischen, formerfindenden Erinnerung, werden die Formen selbständig und lebendig, kristallisieren sich zu einer eigenen Formgestalt, die in einfachen Zeichen die Ergriffenheit des bildnerischen Erlebnisses in sich sammelt: die kleine Insel in der Ewigkeit des Meeres im dunklen Samt der Nacht, träumende Schiffchen auf der stillen Bucht und der Nachtwind melancholisch in Gestalt des dürren Bäumchens und der leuchtenden Form des Felsens. Aber es ist nicht diese Gegenständlichkeit, die uns ergreift, die liegt verschlüsselt in Ton und Form. Es ist der bildgewordenen Kristall des Formgefüges, der uns in reinen bildnerischen Formen dichterische Gegenständlichkeit in seiner Tiefe hermetisch wiederspiegelt: Kristallgebilde zauberischer Kontemplation. Was hier entstanden ist, läßt sich mit einem wundervollen Begriff Goethes umschreiben; entstanden ist ein antwortendes Gegenbild der inneren bildnerisch Vorstellung auf eine ursprüngliche Ergriffenheit des Auges. In der inneren, träumenden Vorstellung entstand aus den Elementen der Wirklichkeit, aus dem „Motiv“, in der formbildenden Arbeit der Erinnerung eine selbständige Bildgestaltung, die nun das Unbekannt-Gesetzliche in der Seele des Künstlers, die Rhythmik der reinen Form, die er in dem Bekannt-Gesetzlichen des Naturbildes angelegt fand, in einem anschaubaren Zeichen sichtbar macht. Das ist das Geheimnis: daß der Künstler nicht etwas erfunden, sondern etwas gefunden hat, etwas Ungeborenes, etwas was bisher in unbekannten Räumen lag und durch die Sensibilität eines Aufmerksamen nun anschaulich wird - und doch das unerklärliche Entzücken eines Wiedererkennens in uns hervorruft. Es ist der gleiche Vorgang des plötzlichen Findens - Wiederfindens - einer künstlerischen Gestalt in Dingen der Welt, den Marcel Proust am Erlebnis der Kirchtürme von Martinville so einmalig und eindringlich beschrieben hat und damit diesen Vorgang als einen geistigen in unser modernes Bewußtsein gehoben hat. Marcel Proust erlebte ihn in seiner hohen intellektuellen Spähre als geistigen Vorgang; Paul Klee erlebte ihn im Bereich des Bildnerischen. Das Genie Paul Klee ist außerordentlich komplex, aber durch ein ganzes Werk zieht sich wie ein roter Faden die Bemühung, die Dinge und Sensationen der Welt in bildnerische Gleichnisse zu verwandeln, in ihnen bildnerische Gestalten zu finden, die in der autonomen Sprache der Form die lyrische Bedeutung der Welt hermetisch einschließen. Die reifsten Leistungen fand Paul Klee nach seiner Ägyptenreise (1928). Die Bilder „Haupt- und Nebenwege“ und „Nekropolis“ - bildnerische Gleichnisse auf die uralte Landschaft Ägyptens und ihre Geschichte - sind die wundervollsten Ergebnisse. Als ich unsere Radierungen im Atelier von Batz sah, habe ich unmittelbar, trotz der äußeren Verschiedenheit, in ihnen die gleiche geistige Anschauung empfunden, die jene meisterlichen Werke Klees hervorgebracht hat. Ich sagte dies Batz, und er bestätigte mir, daß ihm der Entschluß Maler zu werden, gerade vor diesen beiden Bildern gekommen sei, als er sie 1929 auf der Künstlerbund-Ausstellung in Köln sah. Ich sagte dies nicht aus Kritikereitelkeit, sondern weil hierin ein Indiz gesehen werden kann, daß die oben entwickelte Einstellung zu den Blättern von Batz offenbar richtig ist, wenn sie aus einer bloßen Einsicht in die geistige Anschauung die äußerlich so anders aussehenden Quellen so eindeutig angeben kann. Batz, der die Kunstgewerbeschule in Elberfeld besuchte, ging nach dem Erlebnis der KIee‘schen Bilder 1929 an das Bauhaus nach Dessau und arbeitete bei Klee und Kandinsky; 1931 folgte er Klee als Meisterschüler an die Düsseldorfer Akademie, bis Klee 1933 entlassen wurde. Nach einem Studienaufenthalt in Frankreich ging er noch einmal - 1935 - für einige Monate zu Klee nach Bern. Sein künstlerisches Anliegen blieb immer, diese besondere Einsicht, die der ungeheuer weit gespannte Geist Klees andeutete und wieder verließ, festzuhalten und auszubauen, d. h. die in den „Haupt- und Nebenwegen“ Klees erworbenen Einsichten zum Ausgangspunkt der eigenen Arbeit zu machen. Aus diesem Grunde sind auch unsere radierten Blätter so wundervoll eingerastet in die Folgerichtigkeit des modernen bildnerischen Denkens, sie sind logische Fortsetzungen einer sich entwickelnden modernen bildnerischen Kontinuität. Fast möchte ich sagen, auch sie stehen am Anfang eines neuen modernen Stilstromes, der weder zur gegenständlichen, noch zur abstrakten Malerei gehört. Denn die Kameradschaft der geistigen Anschauung reicht bis zu Mataré, ja bis zu so ganz anders scheinenden Persönlichkeiten wie E. W. Nay. Es ist schwierig und doch so erwünscht, ein einleuchtendes Schlagwort für diese Kunstrichtung zu finden. Zwänge man mich dazu, so würde ich die Bezeichnung „Hermetische Malerei“ wählen - „pittura ermetica“ in Analogie zur „poetica ermetica“ der italienischen Dichter Montale und Ungharetti - weil ich damit gleichzeitig ein allgemeines europäisches Verhalten angeben würde, das mit dem 4. Jahrzehnt unseres Jahrhunderts die europäische Sensibilität allenthalben umzugestalten beginnt.
(Geschrieben zu der von ihm 1949 herausgegebenen Mappe mit neun Radierungen von Eugen Batz aus dem Jahr 1932; abgedruckt auch in: Eugen Batz. Radierungen, Stahlätzungen und Prägungen 1924 - 1963, hrsg. v. Freundeskreis, unter Mitarbeit der Galerie Döbele Ravensburg, Oberhausen o.J., S.5-8.)
- RAINER WICK | ZWISCHEN ABSTRAKTION UND FIGURATION: ANMERKUNGEN ZU EUGEN BATZ
Seit genau vier Jahrzehnten, seit Werner Haftmanns Essay aus dem Jahre 1949 über die frühen Radierungen von Eugen Batz, ist von diesem Künstler immer wieder als einer „Entdeckung“ die Rede gewesen bzw. davon, daß es ihn noch zu „entdecken“ gelte. Diese Einschätzung ist paradoxerweise richtig und falsch zugleich. Nach einer stattlichen Zahl von Gruppen- und Einzelausstellungen, die hier aufzulisten nicht der Ort ist, sowie der 1984 bei Belser erschienenen ersten umfassenden Monographie aus der Feder von Dieter Hoffmann mutet es geradezu grotesk an, Batz immer noch als potentielle Entdeckung hinzustellen. Unter Kennern längst bekannt und geschätzt, ist sein Oeuvre einem größeren Kunstpublikum bisher allerdings tatsächlich kaum gegenwärtig. Das hat Ursachen, die sowohl in der Persönlichkeit des Künstlers und in dessen individueller Lebensgeschichte gründen wie auch mit zeitgeschichtlichen Faktoren zusammenhängen.
Aus der späten Einsicht, daß unser gewohntes, festgefügtes Bild von der Geschichte der Kunst dieses Jahrhunderts korrekturbedürftig sei, zumindest aber der Erweiterung bedürfe, hat Rainer Zimmermann vor einigen Jahren auf eine rezeptionsgeschichtliche Lücke hingewiesen, die durch die Kulturbarbarei des Nationalsozialismus entstanden und auch nach dem Krieg kaum mehr geschlossen worden sei. Er spricht in diesem Zusammenhang von der »Kunst der verschollenen Generation« und meint damit jene Künstler der Jahrgänge 1890 bis 1905, die sich, am klassischen Expressionismus anknüpfend, einem »expressiven Realismus« bzw. einer neuen »Existenzmalerei« verpflichtet hatten. Doch nicht nur diese »expressiven Realisten« müssen nach meiner Überzeugung der verschollenen Generation« zugerechnet werden, sondern ebenso all jene, die zwar formal und stilistisch ganz andersartig gearbeitet haben, deren persönliche und künstlerische Existenz im »Dritten Reich« aber gleichermaßen gefährdet und beeinträchtigt war und die nach dem Krieg aus den verschiedensten Gründen kaum mehr am allgemeinen Kunstbetrieb partizipieren konnten.
Für die Künstler des Bauhauses, zu denen auch Eugen Batz gehört, scheint dies auf den ersten Blick nicht zuzutreffen. Schon bald nach Kriegsende, 1950, kam in der neugegründeten Bundesrepublik Deutschland die Rezeption des Bauhauses rasch in Gang. Neben der kleinen Kabinettausstellung »22 Bauhäusler stellen aus« 1950 in Berlin fand im selben Jahr im Münchner Haus der Kunst die große Retrospektive »Die Maler am Bauhaus« statt, organisiert von dem seit Dessau dem Bauhaus nahe stehenden Kunsthistoriker Ludwig Grote. Nach der Hetzkampagne der Nazis gegen die »entartete Kunst« und damit auch gegen die Bauhaus-Maler gelang nun hier in München, am Ort der tiefsten Erniedrigung der Moderne durch die Machthaber des »Dritten Reiches«, ihre glänzende Rehabilitierung. Nicht zu übersehen ist allerdings, daß das Bauhaus-Bild, das sich im Anschluß an diese Ausstellung in den 50er Jahren zu konturieren begann, zunächst alles andere als umfassend war. In der Rückblende erschien diese erste deutsche »Hochschule für Gestaltung« gleichsam als strahlender Olymp, auf dem einige der illustresten Künstler der 20erJahre – Kandinsky, Klee, Feininger, Schlemmer, Moholy-Nagy - zusammengefunden haften, doch blieb der Blick auf die zahlreichen ehemaligen Bauhaus-Schüler, die schon in den 20er und 30er Jahren teilweise ein respektables freikünstlerisches Oeuvre geschaffen haften, höchst lückenhaft. Sie »aufzuarbeiten« war ein Prozeß, der erst erheblich später begann und der bis heute keineswegs abgeschlossen ist.
Zu fragen ist, wie es kommt, daß Eugen Batz genau 70 Jahre nach der Gründung und mehr als ein halbes Jahrhundert nach der Schließung des Bauhauses immer noch zu jenen Bauhäuslern gehört, die nur »Insidern« bekannt sind. Reicht der Hinweis auf die Kunstdiktatur des Nationalsozialismus aus, um dieses Phänomen zu erklären? Gewiß, Batz hatte in den zwölf Jahren, die das »Tausend jährige Reich« bestand, seine künstlerische Produktion nahezu ganz einstellen müssen. In den Jahren 1929 bis 1931 Student am Dessauer Bauhaus, später bis 1933 Meisterschüler von Paul Klee an der Düsseldorfer Kunstakademie, gehörte er nach der »Machtergreifung« gleichsam automatisch zum Kreis jener, die der Bannstrahl der »Entartung« traf. Hinzu aber kam - und damit ist ein zweiter Erklärungsfaktor dafür gefunden, daß der Name Batz nach dem Krieg im Kunstbetrieb nicht sofort zum Begriff wurde - die Notwendigkeit, im elterlichen Betrieb, einer bergischen Fassondreherei, mitzuarbeiten, um die eigene Existenz und die der Familie zu sichern. Solche außerkünstlerischen Tätigkeiten sind, wie allgemein bekannt, der Entfaltung einer Rollenidentität als Künstler nicht gerade zuträglich, entziehen sie doch der künstlerischen Produktion kostbare Zeit und sind überdies hinderlich, wenn es um die Präsenz im öffentlichen Kunstgeschehen geht. Über Jahre hinweg, bis in die späten 50er Jahre, ist Eugen Batz sozusagen zweigleisig gefahren, hat er gleichsam eine Doppelexistenz geführt - in seinem bürgerlichen Brotberuf einerseits und als kompromißlos »moderner« Künstler andererseits, bevor er sich dann in den letzten Lebensjahrzehnten bis zu seinem Tod 1986 ausschließlich der Kunst gewidmet hat. Doch auch in diesen Jahren der Reife und der Ernte hat Batz, ein Stiller im oft allzu hektischen Kunstbetrieb, jeglichem neurotischem Profilierungsgehabe entsagt, hat er jedweden Publizitätsrummel gemieden, um sich ganz auf sein künstlerisches Tun konzentrieren zu können.
Umso bemerkenswerter sind angesichts der skizzierten Umstände Umfang und Qualität seines künstlerischen Oeuvres, dessen Fundamente zweifellos durch sein Studium am Bauhaus gelegt worden sind. Nicht die Utopie einer »neuen Einheit« aus Kunst und Technik, die Gropius schon 1923 programmatisch verkündet hafte, war es, die Eugen Batz in den Bann des Bauhauses geschlagen hatte, sondern die magische Bildwelt Paul Klees. Und neben dem verehrten Lehrer Klee war es Wassily Kandinsky, einer der Eckpfeiler des Bauhauses schon seit Weimar, der das bildnerische Denken des jungen Eugen Batz nachhaltig beeinflußt bzw - richtiger - angeregt hat. Wenn hier von »Anregung« und nicht von »Einfluß« die Rede ist, so deshalb, weil schon ein oberflächlicher Blick auf die frühen Arbeiten des Künstlers aus der Zeit um 1930 deutlich macht, daß sich Batz offen sichtlich nicht, wie manch anderer seiner Mitstudenten am Bauhaus, in epigonalen Bahnen bewegt hat, sondern in seinen abstrakten Kompositionen schon bald zu eigenständigen Bildlösungen gelangte. Beispiele dafür sind in dieser Ausstellung etwa die Kompositionen »Im weißen Bogen«, »Quadrat und Rechteck«, und »Gewinkelt«, alle 1930, die sich durch einen entschiedenen Willen zur formalen und farblichen Reduktion auszeichnen und zum Teil in geradezu puristischer Weise Tektonisches betonen. Dies gilt auch für die Gruppe der in blau-grauen Farbtönen gehaltenen, streng geometrischen Kompositionen des Jahres 1934, während die Komposition »Ein blauer und zwei rote Punkte« von 1932 eher an die arkadische Heiterkeit mancher Gemälde Paul Klees erinnert.
Nach dem Krieg nahm der Künstler die Arbeit genau dort wieder auf, wo er sie unter der Naziherrschaft hatte unterbrechen müssen. Konkret: Er malte zunächst einige Bilder zu Ende, die er 1936 begonnen hatte und die seinerzeit unvollendet geblieben waren. Dieses Detail ist insofern aufschlußreich, als es das Gerede vom 8. Mai 1945 als der »Stunde Null« einmal mehr relativiert bzw. fragwürdig erscheinen läßt. Denn nicht der radikale Neubeginn war für die Zeitsituation kennzeichnend, sondern eher die Suche nach Kontinuität im Sinne einer Rückbesinnung auf kulturelle und künstlerische Traditionen der Zeit vor dem Hitlerfaschismus. Dies zeigen auch die Veranstaltungen der in den ersten Nachkriegsjahren auf einem Schloß bei Bonn aktiven sog. »Donnerstag- Gesellschaft«, zu der neben Joseph Fassbender, Hann Trier, Georg Meistermann, Hubert Berke u.a. auch Eugen Bat gehörte - keine Künstlergruppe im strengen Sinne mit Programm und Statuten, sondern eine lockere Gruppierung von Individualisten, »eine Gemeinschaft Einsamer, eine Verbundenheit Selbständiger«, wie Hans M. Schmidt treffend bemerkt hat. Verbindend war die Absicht, nach den Jahren der Kunstdiktatur des Nationalsozialismus an die progressiven Tendenzen der Zeit vor 1933 anzuknüpfen und zugleich den Anschluß an die internationale Avantgarde zu suchen. Als eine besonders charakteristische Arbeit aus jener Zeit, in der sich schon etwas von der Formenwelt der 50er Jahre andeutet, ist … die Komposition »Ohne Titel« von 1948 zu sehen.
Nun erst, nach dem Krieg und schon mehr als 40 Jahre alt, fand Bat Gelegenheit, sich mit seiner Kunst durch die Herausgabe druckgrafischer Mappenwerke und durch Beteiligungen an Gruppenausstellungen der Öffentlichkeit zu stellen. Einen äußerlichen Höhepunkt seiner Künstlerlaufbahn - Batz hatte inzwischen schon die Fünfzig überschritten - markierte seine Beteiligung an der II. documenta 1959 in Kassel. Gezeigt wurde ein Zyklus aus neun nahezu gegenstandslosen Radierungen von 1932, die seinerzeit nicht hatten erscheinen können und zu denen Werner Haftmann 1949, wie einleitend erwähnt, einen geradezu emphatischen Text geschrieben halte. Obwohl die Bilder von Batz aus den 50er Jahren von der Kritik oft mit dem Informel in Zusammenhang gebracht worden sind, lassen sie nicht selten doch konkrete Gegenstandserfahrungen, insbesondere die von Landschaften, erkennen, was zuweilen sogar durch die Bildtitel - etwa »Das grüne Feld«, 1958 [Nr. 15, Abb. S. 29] oder »Landschaft«, 1961 [Nr. 20,Abb. 5. 37] - bestätigt wird. D.h. es handelt sich hier kaum je um rein subjektive Niederschriften psychischer Befindlichkeiten, um »psychische Automatismen« gar wie sie für einer Reihe der damaligen Abstrakten typisch waren, sondern um freie Umsetzungen geschauter Wirklichkeit mit bildnerischen Mitteln, die in ihrer ästhetischen Wirkungsweise informeller Malerei allerdings außerordentlich nahestehen. Heinrich Hahne hat den Kern der Sache exakt getroffen, wenn er feststellt, die Kunst von Eugen Batz sei »zwischen dem Gegenstand und dem künstlerischen Begriff angesiedelt«, und zwischen »Vorgegebenheit und spontaner Verwandlungskraft, zwischen dem Objektiven und Subjektiven (sei) ihr eigentlicher Ort … Sie ist mehr als Reproduktion des Gegenständlichen und mehr als subjektive Manifestation.“
Dies zeigen auch die Bilder, die auf den zahlreichen Reisen des Künstlers in die Länder des Mittelmeerraumes entstanden. Wie schon manchem Künstler vor ihm - erinnert sei nur an Delacroix‘ Marokkoreise oder an van Goghs Südfrankreichaufenthalt - lieferte auch Eugen Batz der Süden immer neue bildnerische Inspirationen, und mehr als 60 Jahre nach der schon legendären Tunis Reise von Klee, Macke und Moilliet wurde ihm Tunesien zum Erlebnis -sein Licht, seine Farbigkeit, die strenge Geometrie seiner kubischen Architekturen. Doch fiel er nie einem naiven Abbildrealismus zum Opfer sondern stets gelang es ihm, erfindend eigene Bildwelten parallel zur Natur bzw. zur sichtbaren Realität zu erschaffen.
Sinngemäß das Gleiche läßt sich über den Umgang des Künstlers mit dem Figürlichen sagen, das seit den 60er Jahren im Oeuvre von Batz einen immer breiteren Raum einnahm. Es ist interessant zu beobachten, daß bei einem Künstler wie dem fast gleichaltrigen Joseph Fassbender (geb. 1903) die Entwicklung stetig von der Figuration zur Abstraktion verlief, während Batz von der nahezu völligen Abstraktion allmählich zum Figurativen zurückkehrte. Unwillkürlich lassen die Figurenbilder des Künstlers an Oskar Schlemmer denken, der just in jenem Jahr aus dem Bauhaus ausschied, in dem Batz dort sein Studium begann. Nicht daß sich seine Figuralkompositionen, die den Menschen oft statuarisch-schemenhaft in gleichsam imaginären Räumen zeigen, formal an Schlemmer orientierten - und doch gibt es Parallelen, so etwa die Tendenz zur Abstraktion von physiognomischen Besonderheiten, von psychischen Befindlichkeiten und von spezifischen sozialen Situationen. Wie bei Schlemmer erscheinen auch bei Batz die Figuren oft in Gruppen, ohne daß sich aus ihrem Miteinander unmittelbar ein Handlungssinn erschließen ließe, und wie bei Schlemmer besitzen die angedeuteten Räume meist so etwas wie eine metaphysische Grundstimmung. Eines der interessantesten Gemälde, im dem Batz Abstraktion und Figuration miteinander zu versöhnen versucht, ist die Komposition »Licht und Schatten« von 1974 [ Nr. 30, Abb. S.53]. Der geometrisch aufgeteilten oberen Bildhälfte, die an die abstrakten Flächengliederungen der Bilder des Jahres 1932 denken läßt, konfrontiert der Künstler im unteren Teil eine Figurengruppe, über die sich das Licht silbrig-gleißend ergießt, um dann in der rechten, dunklen Schattenzone gleichsam zu erlöschen. Zu Recht hat Dieter Hoffmann notiert, der späte Batz sei ein »Licht- Maler« und es wäre zweifellos ein dankbares Unterfangen, einmal die Metaphysik des Lichtes in diesen Gemälden, ihre Lichtmystik, einer genaueren Untersuchung zu unterziehen.
Daß das Oeuvre von Eugen Bat überaus vielfältig ist, ohne daß dabei die »Einheit des Personalstils« verloren geht, machen die in dieser Ausstellung gezeigten Arbeiten, die einen Zeitraum von mehr als einem halben Jahrhundert überspannen, überzeugend deutlich. Es sind Bilder, die sich durch einen hohen Grad an formaler Reduktion, durch große Sparsamkeit der Mittel, durch knappe Tektonik und durch sensibelste Farb- und Malkultur auszeichnen. Bilder, die ihre Faszination aus dem Umstand beziehen, daß sie sich - nicht nur dann, wenn es um mythologische Themen geht («Daedalus«, 1959/60; »Geburt des Pegasus«, 1962) - trotz aller strukturellen Klarheit letztlich doch dem rationalen Zugriff entziehen und das Geheimnis des künstlerischen Schöpfungsaktes, der aus den Tiefen des Unbewußten gespeist ist, kaum je preisgeben.
Anmerkungen:
1) Gemeint ist Werner Haftmanns Essay zu der von ihm 1949 herausgegebenen Mappe mit neun Radierungen von Eugen Batz aus dem Jahr 1932; abgedruckt auch in: Eugen Batz. Radierungen, Stahlätzungen und Prägungen 1924 -1963, hrsg. v. Freundeskreis, unter Mitarbeit der Galerie Döbele Ravensburg, Oberhausen o.J., S.5-8
2) Dieter Hoffmann: Eugen Batz. Leben und Werk, hrsg. v. Johannes Döbele, Stuttgart—Zürich 1984.
3) Rainer Zimmermann: Die Kunst der verschollenen Generation. Deutsche Malerei des Expressiven Realismus von 1925 bis 1975, Düsseldorf— Wien 1980.
4) Hans M. Schmidt: »Eine Gemeinschaft Einsamer, eine Verbundenheit Selbständiger«. Künstlervereinigungen der Nachkriegszeit, in: Katalogbuch »Aus den Trümmern. Kunst und Kultur im Rheinland und Westfalen 1945-1952«, hrsg. v. Klaus Honnef und Hans M. Schmidt, Köln 1985, S. 423-431.
5) Heinrich Hahne, zit. bei Hoffmann, a.a.O., S.17
6) vgl. dazu das Katalogbuch »Joseph Fassbender. Malerei zwischen Figuration und Abstraktion«, hrsg. v. Wulf Herzogenrath, Köln 1988; der Untertitel dieser Publikation stand auch Pate für den Titel meines Beitrages über Eugen Batz.
7) Hoffmann, a.a.O., S.89.
8) a.a.O., S. 149.
(aus: Katalog „Eugen Batz. Vom Bauhaus bis zur Gegenwart. Bilder aus dem Gesamtwerk. 25.2.-12.4. 1989, Galerie Hedwig Döbele, Ravensburg).
- BIBLIOGRAPHIE
- Arnason, Hjorvadur Havard: Geschichte der modernen Kunst. Malerei, Skulptur, Architektur, Bremen 1970
- Aust, Günther: Kunst nach der Katastrophe, in: Alternativen „Malerei“ 1945/50, Ausstellungskatalog Von der Heydt-Museum, Wuppertal 1973
- Aust, Günther: Vorwort-Nachwort 1978, in: Eugen Batz. Tafelbilder. 1929-1980, hrsg. vom Freundeskreis unter Mitarbeit der Galerie Döbele Ravensburg, Oberhausen 1980
- Bratke, Elke: In aller Freiheit ans Werk!, in: Honnef, Klaus / Schmidt, Hans M. (Hrsg.): Aus den Trümmern. Kunst und Kultur im Rheinland und in Westfalen 1945-1952, Rheinisches Landesmuseum, Bonn 1985
- II. documenta ’59. Kunst nach 1945, Bd. 1 Malerei, Köln 1959
- Haftmann, Werner: Deutsche abstrakte Maler, Baden-Baden 1953, (Der Silberne Quell, Bd. 11)
- Haftmann, Werner: Malerei im 20. Jahrhundert, München (11954) 71987
- Haftmann, Werner: Essay, in: Eugen Batz. Tafelbilder. 1929-1980, hrsg. vom Freundeskreis unter Mitarbeit der Galerie Döbele, Ravensburg, Oberhausen 1980
- Haftmann, Werner: Essay 1946 – 1947, in: Eugen Batz. Radierungen, Stahlätzungen und Prägungen 1924-1963, hrsg. vom Freundeskreis unter Mitarbeit der Galerie Döbele, Ravensburg, Oberhausen 1982
- Hahne, Heinrich: Vorwort, in: Eugen Batz. Radierungen, Stahlätzungen und Prägungen 1924-1963, hrsg. vom Freundeskreis unter Mitarbeit der Galerie Döbele, Ravensburg, Oberhausen 1982
- Held, Jutta: Kunst und Kunstpolitik in Deutschland 1945-49. Kulturaufbau in Deutschland nach dem 2. Weltkrieg, Berlin 1981
- Hentzen, Alfred: Der antike Mythos in der neuen Kunst. Ausstellung in der Kestner-Gesellschaft Hannover, in: Das Kunstwerk III/Heft 5, 1950
- Hoffmann, Dieter: Aquarelle von Eugen Batz, in: Eugen Batz. Aquarelle, Gouachen, Pastelle 1926-1980, hrsg. vom Freundeskreis unter Mitarbeit der Galerie Döbele, Ravensburg, Oberhausen 1981
- Hoffmann, Dieter: Eugen Batz. Leben und Werk, hrsg. von Johannes Döbele, Stuttgart und Zürich 1984
- Kammann, Uwe: Sehen in Texturen, in: Eugen Batz. Fotografien von 1928-1978, hrsg. vom Freundeskreis, Oberhausen 1979
- Kammann, Uwe: Eugen Batz. Spuren und Strukturen, in: Wick, Rainer (Hrsg.): Das Neue Sehen. Von der Fotografie am Bauhaus zur subjektiven Fotografie, München 1991
- Schütze, Yvonne: Eugen Batz. Vom Bauhaus zum Informel. Kontext. Schriftenreihe für Kunst, Kunsterziehung und Kulturpädagogik an der Bergischen Universität Gesamthochschule Wuppertal, Bd. 2, 1999
- Trier, Eduard: Rheinische Malerei des 20. Jahrhunderts, in: Das Kunstwerk VIII/Heft 1, 1954
- Vollmer, Hans: Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler des XX. Jahrhunderts, Bd.1, Leipzig 1953
- Wangler, Wolfgang: Bauhaus – 2. Generation, Köln 1980
- Westheim, Paul: Künstler im Reich. Zur Kunstblatt-Ausstellung im Reckendorfhaus, Berlin, in: Das Kunstblatt, 1930, S. 257-260
- Wick, Rainer K. : „Eugen Batz. Ein Bauhaus-Künstler fotografiert“ und „Zwischen Abstraktion und Figuration. Anmerkungen zu Eugen Batz“, in: Bauhaus. Kunst und Pädagogik, Artificium. Schriften zur Kunst und Kunstvermittlung, hg. von Kunibert Hering, Band 33, 2009, S.354-375.
- AUSSTELLUNGSKATALOGE
- Wandlungen bildnerischer Formelemente. Entwicklungsreihen aus dem Werk von Eugen Batz und Fritz Levedag, Ausstellungskatalog Bauhaus-Archiv, Darmstadt 1964 (darin Hans Maria Wingler: Eugen Batz)
- Eugen Batz. Gemälde und Aquarelle, Ausstellungsleporello Von der Heydt-Museum Wuppertal 1965 (mit einem Text von Günther Aust)
- Eugen Batz. Gemälde, Aquarelle, Zeichnungen, Radierungen, Ausstellungskatalog Kunst- und Museumsverein Wuppertal 1965 (mit einem Vorwort von Günther Aust)
- Eugen Batz. Gemälde und Aquarelle, Ausstellungsleporello Von der Heydt-Museum Wuppertal (Studio) 1975 (mit einem Text von Günther Aust)
- Eugen Batz. Aquarelle, Gouachen und Pastelle 1932-1976, Katalog Kunsthandlung Günter Fuchs, Düsseldorf 1977 (darin Jürgen Ahrens: Die Einheit von Realität und Imagination, und Dieter Hoffmann: Aquarelle von Eugen Batz)
- Eugen Batz. Gemälde und Graphik. Retrospektive 1928-1978, Ausstellungskatalog Museum Schloss Hardenberg, Velbert-Neviges 1978 (darin Günther Aust: Vorwort-Nachwort 1978 und Werner Haftmann: Einleitung zu den Radierungen von 1949)
- Das experimentelle Photo in Deutschland 1918 – 1940, Ausstellungskatalog Galeria del Levante München 1978 (mit einem Text von Emilio Bertonati)
- Eugen Batz. Tafelbilder, Aquarelle, Zeichnungen, Ausstellungskatalog Museum Schloss Hardenberg, Museen der Stadt Velbert, 1985 (darin Heinrich Hahne: Grußwort an Eugen Batz, und Cornelia Will: Ein Blumenstrauß für Eugen Batz)
- Eugen Batz. Fünf Jahrzehnte seit dem Bauhaus, Ausstellungsleporello Galerie Döbele, Stuttgart, 1986
- Eugen Batz. Tunesische Strukturen – Aquarelle und Fotografien im Kontext, Ausstellungskatalog Galerie Döbele, Stuttgart, 1989 (darin Uwe Kammann: Identität als inneres Maß)
- Eugen Batz. Vom Bauhaus bis zur Gegenwart. Bilder aus dem Gesamtwerk, Ausstellungskatalog Galerie Döbele, Ravensburg 1989 (darin Rainer Wick: Zwischen Abstraktion und Figuration. Anmerkungen zu Eugen Batz)
- Eugen Batz. Zwischen Abstraktion und Figuration, Ausstellungskatalog Kunstverein Solingen in der Städtischen Galerie im Deutschen Klingenmuseum Solingen und Artforum Schloss Hackhausen 1990/91 (darin Rainer K. Wick: Notizen zu Eugen Batz)
- Eugen Batz. Radierungen – Sammlung Gerhard und Brigitte Hartmann II, Ausstellungskatalog Städtische Galerie Albstadt 1997 (darin Yvonne Schütze: Eugen Batz. Radierungen, Stahlätzungen und Prägungen)
- Eugen Batz. 1905-1986. Zum 100. Geburtstag. Gemälde und Aquarelle. Ausst.-Kat. Von der Heydt-Museum, Wuppertal, hg. Von Sabine Fehlemann, mit Beiträgen von Antje Birthälmer, Beate Eickhoff und Dieter Hoffmann, 2005.
- Eugen Batz. Meisterschüler von Paul Klee. Arbeiten auf Papier, hg. von der Stiftung Kunst, Kultur und Soziales der Sparda-Bank West, Düsseldorf 2007.
- Wick, Rainer, K.: Eugen Batz. Ein Bauhaus-Künstler fotografiert. Kontext. Schriftenreihe für Kunst, Kunsterziehung und Kulturpädagogik, hg. v. Prof. Dr. Rainer K. Wick, Bergische Universität Wuppertal, Bd. 6., 2007.
- Donnerstag-Gesellschaft. Schloss Alfter 1947-1950 und die Zeit danach. Eugen Batz, Hubert Berke, Joseph Fassbender, Georg Meistermann, Hann Trier, hg. von Zellmayer Galerie, Berlin 2010
- Aus der Form geboren. Schüler der Klasse Paul Klee, Düsseldorf 1931-1933 und die Zeit danach, hg. von Zellermayer Galerie, Berlin 2011